Romane
In Trubschachen
Roman, Die Gesamtausgabe, 2022
Roman eines Aufenthalts in einem Emmentaler Dorf zwischen Weihnachten und Neujahr. Wurde zu einem Kultbuch.

Um die Jahreswende könnte man verreisen, zum Beispiel ins Emmental. Während der Fahrt würde man auf die im „Paris Match“ abgedruckte Geschichte des Herzogs von Windsor – des ehemaligen englischen Königs, der aus Neigung zu einer Bürgerlichen auf das Königsamt verzichtet hat – aufmerksam werden. Im „Hirschen“ quartiert man sich gewissenhaft ein und bemüht sich wegen der Arbeit, die man hier voranzutreiben gedenkt, um ein regelmässiges Leben. Man lernt den Ort und seine nähere Umgebung kennen. Die reichhaltigen Mahlzeiten werden zu den einzigen Richtzeiten im Tagesablauf. Man schläft viel, liest in Biographien des Immanuel Kant. Die eigene Arbeit zögert man immer weiter hinaus.
Auf langen Spaziergängen nimmt die Beobachtungsgabe zu: das Zeitgefühl verändert sich, Bekanntes wirkt fremd. In seiner „Emmentaler Rede“ erzählt der Lehrer über die geographischen und historischen Verhältnisse dieser Region. Über die Leinen- und Nahrungsmittelindustrie, aber auch über Fälle von Tierquälerei, Inzucht und Mord. Todesahnungen werden bedrohlich.
Am historischen Beispiel, dem Leben und der Philosophie Kants, und am aktuellen Erleben eines zwischen den grossen Städten gelegenen Durchgangstales werden die Bedingungen, unter denen Leben verläuft, offensichtlich. Die grosse »Rede von der Pflicht« handelt deshalb auch vom falschen Leben, von den »menschenfeindlichen Lebensbedingungen«.
» Stimmen und Leseprobe» Dieses Buch kaufen » als eBook
Stimmen
„E. Y. Meyers Roman Die Rückfahrt
ist ein Werk von ausserordentlicher Gedankenfülle
und Gedankendichte, eines der wenigen Bücher
der Gegenwartsliteratur, die man zwei- und dreimal
wird lesen wollen. Wahre Dichtung ist utopischer Weltentwurf,
oder, wie E. Y. Meyer bescheidener evoziert: Die Wiederherstellung
der Welt.“
Hermann Burger, Merkur
„Die Rückfahrt stellt die Frage
nach dem richtigen Leben. Die bis ins Detail präzise
Beschreibung einer Existenz und einer Gesellschaft,
in der die Suche nach dem richtigen Leben für
alle unabwendbar geworden ist, die konstruktive Eleganz,
mit der die Geschichte erzählt wird, überzeugen
und bewegen mich.“
Klaus Podak, Süddeutsche Zeitung
„Die Kunst, Zeit rückwärts laufen
zu lassen.“
Alice Vollenweider, Die Weltwoche
Leseprobe
Sie standen auf dem Münsterturm und schauten
über die Stadt und das Land, über das sich
die Dämmerung breitete. Das Amt für Denkmalpflege
lag weit unten.
Aus der Turmhalle drangen über
den Treppenaufgang die Töne der einsetzenden
Orgel bis zu ihnen hinauf, und über ihre Köpfe
zogen ungezählte Schwärme von Fledermäusen
hinweg, die die alte Turmkappe verliessen und über
die ganze Stadt hinflatterten.
Als die letzten Fledermäuse
den Turm verlassen hatten und das Geräusch der
Flügelschläge verstummt war, das wie das
Knattern von Segeln im Wind getönt hatte, glaubten
sie ausser dem entfernten Orgelspiel noch ein immer
lauter werdendes Kratzen zu hören, das sich der
breiten Balustrade der obersten Münstergalerie
näherte, auf der sie sich befanden. Und als sie
an die Balustrade hinantraten und über sie hinweg
der Fassade entlang hinunterblickten, sahen sie, wie
dicht zusammengedrängt und von allen Seiten her
unzählige kleine affenartige Wesen, die sich
in ihrer Farbe nicht im geringsten von der des Sandsteins
des Münsters unterschieden, mit einer grossen
Geschicklichkeit und Geschwindigkeit von den Fialen
der Strebepfeiler her, über die Strebebogen und
die Turmfassade auf die Galerie zukletterten.
Alles
an ihnen war sandsteinfarben, so dass es aussah, als
ob Teile der Münsterfassade in Bewegung geraten
seien, und als die ersten von ihnen die Balustrade
erreichten, sahen sie, dass es Konsolen-, Türpfosten-,
Türsturz-, Konsolenträger-, Bogenfeld- und
Archivoltenfiguren sowie zu grotesken, widernatürlichen
Gestalten geformte Wasserspeier waren, die ohne aufeinander
Rücksicht zu nehmen panikartig den Turm erklommen
und in deren Sandsteinaugen Angst stand.
Als er zum
Denkmalpfleger hinüberblickte, sah er, dass sich
dieser schon wieder aufgerichtet hatte und ihn mit
hochgezogenen Augenbrauen und weitgeöffneten,
wahnsinnsgefüllten Augen ansah – so dass
er erschrocken vor ihm zurückwich – und
dass sich dessen Gesicht zu einem breiten Grinsen
verzog, das unvermittelt in ein unmenschliches, höhnisches
Gelächter von einer unvorstellbaren Lautstärke
überging.
Dann begann die dicke Steinplatte des
Galeriebodens und mit ihr schliesslich der ganze Turm
langsam auseinander zu brechen, so dass sich der Denkmalpfleger,
ohne in seinem Gelächter innezuhalten, mit seiner
Turmhälfte und den verzweifelt Halt suchenden
Sandsteinfiguren, die reihenweise in die Tiefe fielen,
langsam von ihm entfernte und ihm, gerade noch bevor
die beiden Turmhälften in sich zusammenstürzten,
mit einer Donnerstimme durch das ohrenbetäubende
Krachen und die immer lauter werdende Orgelmusik hindurch
die Worte: MACHS NA! zurief.
Die Rückfahrt
Roman, Die Gesamtausgabe, 2022
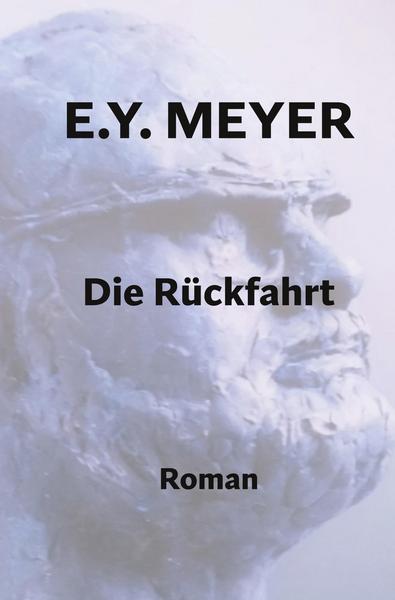
„Die Rückfahrt“ gilt als OPUS MAGNUM von E. Y. Meyer. Es ist ein Entwicklungs- und Gesellschafts-Roman in einem.
Der Roman erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, von seinen Schwierigkeiten mit dem Leben im reichsten Land der Welt und dem Versuch, sich mit der Hilfe eines Psychiaters auf eine neue Existenz in der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Schweiz vorzubereiten. Sie erzählt von den Gesprächen mit einem Denkmalpfleger und von der Entscheidung des jungen Mannes, den Lehrerberuf aufzugeben.
Mit der eigenen Vergangenheit steigt die historische auf. Kunstwerke, Denkmäler, Erziehung und politische Geschichte verbinden sich mit den persönlichen Erfahrungen, lassen sie wachsen und heben sie im Gang der Geschichte auf.
„Die Rückfahrt“ meint nicht nur die letzte Fahrt mit dem Denkmalpfleger, sie meint ebenso die Umkehr im Sinne einer geschichtlichen Wende, die Abkehr von einem sich über grosse Zeiträume erstreckenden Vernichtungsprozess des Lebens.
» Stimmen und Leseprobe» Dieses Buch kaufen » als eBook
Stimmen
„E. Y. Meyers Roman Die Rückfahrt
ist ein Werk von ausserordentlicher Gedankenfülle
und Gedankendichte, eines der wenigen Bücher
der Gegenwartsliteratur, die man zwei- und dreimal
wird lesen wollen. Wahre Dichtung ist utopischer Weltentwurf,
oder, wie E. Y. Meyer bescheidener evoziert: Die Wiederherstellung
der Welt.“
Hermann Burger, Merkur
„Die Rückfahrt stellt die Frage
nach dem richtigen Leben. Die bis ins Detail präzise
Beschreibung einer Existenz und einer Gesellschaft,
in der die Suche nach dem richtigen Leben für
alle unabwendbar geworden ist, die konstruktive Eleganz,
mit der die Geschichte erzählt wird, überzeugen
und bewegen mich.“
Klaus Podak, Süddeutsche Zeitung
„Die Kunst, Zeit rückwärts laufen
zu lassen.“
Alice Vollenweider, Die Weltwoche
Leseprobe
Sie standen auf dem Münsterturm und schauten
über die Stadt und das Land, über das sich
die Dämmerung breitete. Das Amt für Denkmalpflege
lag weit unten.
Aus der Turmhalle drangen über
den Treppenaufgang die Töne der einsetzenden
Orgel bis zu ihnen hinauf, und über ihre Köpfe
zogen ungezählte Schwärme von Fledermäusen
hinweg, die die alte Turmkappe verliessen und über
die ganze Stadt hinflatterten.
Als die letzten Fledermäuse
den Turm verlassen hatten und das Geräusch der
Flügelschläge verstummt war, das wie das
Knattern von Segeln im Wind getönt hatte, glaubten
sie ausser dem entfernten Orgelspiel noch ein immer
lauter werdendes Kratzen zu hören, das sich der
breiten Balustrade der obersten Münstergalerie
näherte, auf der sie sich befanden. Und als sie
an die Balustrade hinantraten und über sie hinweg
der Fassade entlang hinunterblickten, sahen sie, wie
dicht zusammengedrängt und von allen Seiten her
unzählige kleine affenartige Wesen, die sich
in ihrer Farbe nicht im geringsten von der des Sandsteins
des Münsters unterschieden, mit einer grossen
Geschicklichkeit und Geschwindigkeit von den Fialen
der Strebepfeiler her, über die Strebebogen und
die Turmfassade auf die Galerie zukletterten.
Alles
an ihnen war sandsteinfarben, so dass es aussah, als
ob Teile der Münsterfassade in Bewegung geraten
seien, und als die ersten von ihnen die Balustrade
erreichten, sahen sie, dass es Konsolen-, Türpfosten-,
Türsturz-, Konsolenträger-, Bogenfeld- und
Archivoltenfiguren sowie zu grotesken, widernatürlichen
Gestalten geformte Wasserspeier waren, die ohne aufeinander
Rücksicht zu nehmen panikartig den Turm erklommen
und in deren Sandsteinaugen Angst stand.
Als er zum
Denkmalpfleger hinüberblickte, sah er, dass sich
dieser schon wieder aufgerichtet hatte und ihn mit
hochgezogenen Augenbrauen und weitgeöffneten,
wahnsinnsgefüllten Augen ansah – so dass
er erschrocken vor ihm zurückwich – und
dass sich dessen Gesicht zu einem breiten Grinsen
verzog, das unvermittelt in ein unmenschliches, höhnisches
Gelächter von einer unvorstellbaren Lautstärke
überging.
Dann begann die dicke Steinplatte des
Galeriebodens und mit ihr schliesslich der ganze Turm
langsam auseinander zu brechen, so dass sich der Denkmalpfleger,
ohne in seinem Gelächter innezuhalten, mit seiner
Turmhälfte und den verzweifelt Halt suchenden
Sandsteinfiguren, die reihenweise in die Tiefe fielen,
langsam von ihm entfernte und ihm, gerade noch bevor
die beiden Turmhälften in sich zusammenstürzten,
mit einer Donnerstimme durch das ohrenbetäubende
Krachen und die immer lauter werdende Orgelmusik hindurch
die Worte: MACHS NA! zurief.
Das System des Doktor Maillard oder Die Welt der Maschinen
Roman, Die Gesamtausgabe, 2022

Wenn in einem Roman ein Autofahrer ein einsames Gebäude betritt, dann erwartet ihn irgendeine Überraschung. Dieser Roman beginnt so, dass ein Doktorand der Psy-chologie namens Edgar Ribeau am Tor eines Schlosses steht, das jetzt „Clinique Château Europe“ heisst. Er will den berühmten Psychiater Doktor Maillard treffen und sich mit dessen neuer Heilmethode vertraut machen - dem »System der Beschwichti-gung«. Nach einigen Drinks eröffnet ihm Maillard jedoch, dass er inzwischen die Me-thode gewechselt hat und nun einem amerikanischen Forscherpaar namens Tarr und Fether folgt.
Wenn Ribeau die Geschichte von Edgar Allan Poe aus dem Jahr 1845 gelesen hätte, dann würde er nun ganz sicher wissen, dass in dieser Klinik die Irren regieren. Er müss-te sich schnell aus dem Staube machen. Aber der getarnte Poe-Hinweis war ja wohl eher für den kundigen Leser da, der natürlich schon vorher gemerkt hat, dass Maillard und seine »Gäste« nicht ganz bei Trost sind. Und der Name »Klinik Schloss Europa« zeigte ja von vornherein, dass hier nicht nur private Verrücktheiten zu erwarten sind, sondern solche von kontinentaler Bedeutung.
E. Y Meyer hat Philosophie, Geschichte und Literatur studiert. An seinem Wissen lässt er uns intensiv teilhaben. Äussere Spannungsmomente und Gruseleffekte sind nur hinzugegeben, der Roman lebt vom intellektuellen Disput. Den führt Maillard mit dem Doktoranden und dem Doktor Anseaume.
Mit der sokratisch angehauchten Logik und dem Fanatismus eines Wahnsinnigen entwickelt Maillard seinen Plan einer neuen Weltordnung. Dafür brauchte der Autor ja nur weiterzudenken, was in der Realität Europas für jeden sichtbar ist. Vieles deutet darauf hin: Wir leben in einem grossen Irrenhaus, die Vernunft ist unter Verschluss gehalten. Das »System« des Doktor Maillard ist ausgeklügelt, und es ist für den Leser eine vergnügliche Herausforderung, die Konstruktion zu durchschauen.
» Stimmen und Leseprobe» Dieses Buch kaufen » als eBook
Stimmen
„Hinsichtlich der Neigung zu philosophischen
und naturwissenschaftlichen Fragestellungen kommt
E. Y. Meyer Dürrenmatt am nächsten.“
Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur
im 20. Jahrhundert
„Der Roman entfaltet einen eigentümlichen
konstruktivistischen Witz, der in eine phantastische
Menschheitssymbolik übergeht. Wem es gelingt,
die Ungeniertheit dieses Erzählers zu teilen,
der kann ein grosses intellektuelles Vergnügen
haben. Ein so schräges wie eindrucksvolles Wort
zum Ernst der Lage.“
Frankfurter Rundschau
„Irrenhaus Europa. Das System des Doktor Maillard
ist auf eine wahnwitzige Weise ausgeklügelt.“
Neues Deutschland
Leseprobe
Das, was dem Doktoranden hier geboten wurde, unterschied
sich vollständig von dem, was er bisher erlebt
hatte, und nach den Dingen zu schliessen, die er auf
dem Tisch sah, gab es, entgegen seinen Erwartungen,
anscheinend doch genau das phantastische Menü,
das Clicquot und Rocquembert angekündigt hatten
– ein Essen also, das in einem totalen Gegensatz
etwa zu der Nahrung stand, die, wie Laing ihm in Saint-Tropez
geschildert hatte, in Kingsley Hall üblich gewesen
war, wo sich in schlechten Zeiten in der Küche
leere Milchflaschen, aus denen noch die letzten Reste
geschlürft worden seien, aufgetürmt und
sämtliche Wände wie Jackson-Pollock-Gemälde
ausgesehen hätten, für die statt Farbe Eigelb
verwendet worden sei, dieweil in der Speisekammer
gähnende Leere geherrscht habe.
Und zudem schien Maillard, wie Ribeau zufrieden feststellte,
auch überhaupt nichts gegen die Beziehung zu
haben, die zwischen ihm und seiner Mitarbeiterin entstanden
war – denn der grosse Mann richtete seine Aufmerksamkeit
nun nicht etwa auf die sich ostentativ eng an den
Doktoranden schmiegende junge Amerikanerin, sondern
voll auf die ihr gegenübersitzende Madame Rougemont,
die nervös auf ihrem Stuhl hin und her rutschte
und dabei ihren enormen, faltenreichen Busen immer
wieder in beachtliche Schwingungen versetzte.
„Was ist denn, Madame Rougemont?“ wollte
er von der rothaarigen Dame wissen – und diese
antwortete mit leicht pikierter Stimme: „Ich
möchte meinen Platz wechseln, Mössjö
lö tirektör!“
„Und wohin möchten Sie sich denn setzen?“
„Neben Edgar!“ kam, wie aus der Pistole
geschossen, die Antwort.
„Aber nein, Madame Rougemont, das geht doch
nicht“, lachte Maillard. „Neben Edgar
sitzt unsere liebe Linda!„
„Sa allorrs!“ sagte die Sängerin
entrüstet.
„Bitte?!“
„Sie müssen wissen, was Sie tun!“
„Sehr richtig, meine Liebe“, sagte Maillard.
„Man kann alles verwerfen, was man will, auch
das Wissen selbst, aber man muss wissen, was man tut!“
Venezianisches Zwischenspiel
Eine Novelle, Edition Königstuhl, 2021
Ein Mord, den keiner beging.
Eine italienische Reise in eine venezianische Falle.

Dies ist eine Neuauflage der Novelle aus Anlass des 75. Geburtstages des Autors E. Y. Meyer am 11. Oktober 2021 mit einem neu geschaffenen superben Nachwort von Samuel Moser, das dem Leser eine grossartige und ausserordentlich geglückte Einordnung dieser Novelle ins gesamte Werk von E. Y. Meyer anbietet.
Vier Theaterleute und ein Schriftsteller reisen von Paris nach Venedig, um zu feiern. Die Vergnügungsreise entwickelt sich völlig überraschend zu einem Alptraum. Als sie in der Serenissima eintreffen, ist die legendäre Harry's Bar schon geschlossen, die Vorfreude darauf dahin. Riccardo Malino, ein venezianischer Dramatiker, wird zu ihrem Cicerone. Er führt die Venedig-Besucher durch das Labyrinth der Stadt, lädt sie in kleine versteckte Kneipen ein, lässt sie hinter feudalen Fassaden des Canal Grande blicken.
Grosszügig stellt er ihnen für einige Tage sein in der Nähe des »Teatro La Fenice« gelegene Haus zur Verfügung. Eine alte venezianische Falle droht auf erschreckende Weise neue Wirklichkeit zu werden. In einer gespenstischen, unheimlichen Nacht kommt es zu der unerhörten Begebenheit, die das Herz dieser Novelle ausmacht. Die italienische Reise wird zu einer Reise in die Abgründe der menschlichen Seele. Ein geradezu Faustisches Erlebnis...
» Stimmen und Leseprobe » Dieses Buch kaufen» als eBook
Stimmen
„Das Geschlecht des Bösen. E. Y. Meyers
virtuoses Venezianisches Zwischenspiel.“
Neue Zürcher Zeitung
„Ein Mord, den keiner beging. Aus der Konfrontation
der Gedanken mit der realen Welt bezieht die Novelle
ihre Vielschichtigkeit und unterschwellige Spannung.
Das Janusköpfige lauert in allen Bereichen.“
Stuttgarter Zeitung
„The novel shows a master hand“
World Literature Today
Leseprobe
Die Unterbrechung der Romanarbeit sollte nur eine
kurze sein, einige Tage bis höchstens eine Woche,
und hätte doch beinahe ihr Ende bedeutet.
Ob man das Ereignis, um das es hier geht, wirklich
als so gravierend einstufen oder ob man es anders
sehen will, hängt von den Moralvorstellungen
des Einzelnen ab. In einem Jahrhundert, in dem millionenfacher
technokratisch geplanter Mord stattgefunden hat, die
Atombombe erfunden, gebaut und eingesetzt wurde, ist
auch die Beurteilung von Mord relativ geworden.
Alles scheint möglich und als Wertvorstellung
akzeptierbar. Und vielleicht wird der Mord, wenn man
später auf unser Jahrhundert zurücksieht,
möglicherweise sogar als die Kunst angesehen,
die es kennzeichnet, wie andere Jahrhunderte durch
das Gebet oder das Betteln gekennzeichnet waren.
Das Böse, das es in der Welt gibt, beginnt oft
erstaunlich banal und entfaltet plötzlich eine
grosse Wirkung.
Der Ritt
Roman, Die Gesamtausgabe, 2022
Der menschliche Ritt nach dem Sinn des Lebens.
Am Beispiel des legendären Schweizer Schriftstellers
Jeremias Gotthelf.
„Am ersten Tag des Jahres 1831 ritt er, von Sinnlosigkeit umlagert, in das winterliche Emmental.“ Mit diesem Satz beginnt der Roman, in dem der Ritt des Albert Bitzius, wie Gotthelf mit bürgerlichem Namen hiess, von Bern nach Lützelflüh geschildert wird.
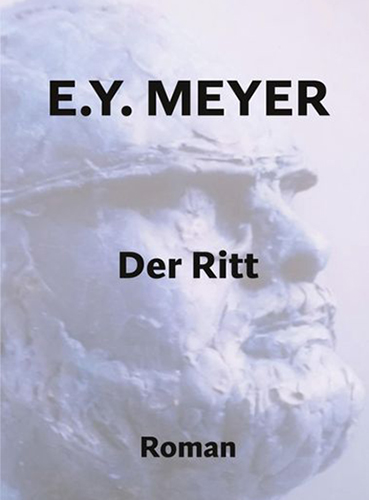
Dass die Vikariatstelle, die er dort antrat, die bereits vierte nach jenen in Utzenstorf, Herzogenbuchsee und Bern, seine letzte sein würde und dass er bis zu seinem Tod in Lützelflüh bleiben sollte, wusste er nicht. Dass er neben seiner Tätigkeit als Pfarrer in nur achtzehn Jahren ein gewaltiges literarisches Werk (20'000 Druckseiten) schaffen und unter dem Namen Jeremias Gotthelf veröffentlichen würde, hätte er höchstens ahnen können.
Der Ritt von Bern nach Lützelflüh erwies sich im Leben des Albert Bitzius nachträglich als die entscheidende Zäsur.
Wie dieser Ritt verlief, was während der fünf Stunden in dem dreiunddreissigjährigen Mann vorging, wie er sein bisheriges Leben sah, was für Erinnerungen in ihm auftauchten, mit welchen Dämonen er zu kämpfen hatte, was er von der Zukunft erwartete, wird erzählerisch nachvollzogen.
Nicht Jeremias Gotthelf, der berühmte, heute von Klischees überlagerte Schriftsteller, wird gezeigt, sondern der wenig bekannte junge Mann, der er zuvor war. Der wilde Albert Bitzius, in dem die Voraussetzungen für das spätere Schöpfertum entstanden. Route des Ritts: Bern – Gümligen - Rüfenacht – Worb - Bad Enggistein - Walkringen - Bigenthal – Gomerkinden – Schafhausen – Goldbach - Lützelflüh.
» Stimmen und Leseprobe » Dieses Buch kaufen» als eBook
Stimmen
„Der Ritt durch das gärende
Universum des jungen Pfarrers unterwegs zu seinem
geistigen Ort als Schriftsteller und zugleich in das
reale winterliche Lützelflüh ist ein Husarenritt,
der seines Temperaments würdig ist. Eine ungemein suggestive und kraftvolle Prosa, zu
der man jeden Leser nur beglückwünschen
kann.“
Adolf Muschg
„Er lässt Bitzius reiten und wie!“
Christophe Pochon, Bieler Tagblatt
„Meyer hat stilsicher auf wenigen Seiten einen
grossen Roman geschrieben, in einer literarischen
Qualität, die der Leser in den Werken Gotthelfs
nicht immer findet.“
Friedrich Seven, Zeitzeichen, Berlin
„Beim Lesen entsteht mehr und mehr ein Sog,
ein Rhythmus, der vorbestimmt ist wie die Gedanken
des Reiters durch den Gang des Pferdes. Trotz der Knappheit: "Der Ritt" hat durchaus
etwas Episches. Manchmal hat man gar den Eindruck, Meyer würde
selbst zu Gotthelf. Man liest ihn gern, den "Ritt". Sein Staccato
der Sätze und der Gedanken prägt sich ein.“
Konrad Tobler, Berner Zeitung
„Jene, die wirklich etwas über Jeremias
Gotthelf erfahren wollen, sollten E. Y. Meyers neuen
Roman lesen. 'Der Ritt' schildert in hinreissender
Sprache, wie der noch unbekannte Vikar Albert Bitzius
nach Lützelflüh reitet und macht fassbar,
wie er dort zu einem der besten Schriftsteller des
Landes wurde.“
Coopzeitung
» DEUTSCHE BüCHER. Forum für Literatur
» Basler Zeitung 1.12.04
» Bieler Tagblatt 26.11.04
» Coopzeitung 17.11.04
» Zeitzeichen November 04
» Schweizer Illustrierte 27.9.04
» Bernerzeitung 28.8.04
» Bieler Tagblatt 26.8.04
» Bernerzeitung vom 16.1.04
» Bernerzeitung vom 19.1.04
» NZZ vom 19.1.04
Leseprobe
AM ERSTEN TAG des Jahres achtzehnhunderteinunddreissig
ritt er, von Sinnlosigkeit umlagert, in das winterliche
Emmental.
Während das Pferd kraftvoll den Muristalden hinaufstapfte,
sah er auf die in der Tiefe versinkende Stadt zurück.
Die langen Häuserreihen wirkten streng. Dominiert
wurden sie vom Turm des Münsters.
Der Ort, der die halbinselartige Flussschlaufe ausfüllte,
sah wie ein Walfisch aus, in dessen Rücken Harpunen
steckten, die von vergeblichen Fangunternehmungen
und Tötungsversuchen stammten. Jetzt, da Schnee
auf den Dächern lag, war das Tier ein weisser
Wal.
Rauch stieg aus Kaminen auf. Der Walfischrücken
dampfte.
Im fahlen Licht des Wintertags hatte die Klarheit
der Häuseranordnung, ihre Wohlgeordnetheit, die
Sicherheit und Ruhe versprechen sollte, auch etwas
Bedrohliches.
Sie verkörperte die Macht der Menschen, die fähig
war, ihren Willen der Natur aufzuzwingen. Die einen
Wald verschwinden lassen konnte und an seiner Stelle
eine geballte Ansammlung steinerner Bauwerke hinzustellen
imstande war.
Und der Herr gebot dem Fisch, und er spie Jonas
an Land.
Unvermittelt schlug er die Absätze der Stiefel
in den Unterbauch der Stute, zwang sie, den letzten
Teil des Hangs und die nachfolgende ebene Strecke
im Galopp zurückzulegen.
Männergelächter umdröhnte seinen Kopf.
Spotterfüllte Augen blitzten auf. Bärtige
Münder entblössen verfaulte Zähne.
Si vis pacem, para bellum.
Fort. In fremde Kriegsdienste.
Das Pferd wieherte. Er verlangsamte das Tempo. Strich
dem Tier über den Hals.
So schickte ihn Gott der Herr fort aus dem Garten
Eden, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen
war.
Und er vertrieb den Menschen und liess östlich
vom Garten Eden die Cherube sich lagern und die Flamme
des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baume des Lebens
zu bewachen.
Er hatte der Versuchung nicht widerstanden.
Die Berufung nach Bern ist ehrenvoll, aber wird
sie es auch bleiben für mich? Auf dem Land konnte
ich Nutzen stiften, von Bedeutung sein. Werde ich
es auch in der Stadt können? Dies legt mich schlaflos.
Man hatte nicht versäumt, ihn auf das grossteils
gebildete Publikum der Stadtgemeinde hinzuweisen,
ihm sorgfältige Ausarbeitung der Kanzelvorträge
angeraten, die Erwartung ausgesprochen, dass er sich
bestreben werde, dem, wie man schrieb, ehrenvollen
Zutrauen nach bestem Vermögen zu entsprechen.
Was ich übernommen habe, führte ich
bis dahin immer ehrenvoll aus. Wie ich aber auf diesem
Posten genügen sollte, wollte mir nicht aufgehen.
Dieses war die Hauptursache meiner Beängstigung.
Eine zweite, geringere ist finanziell.
Mit vierhundert Franken Einkommen springt man in Bern
nicht nur nicht weit, sondern gar nicht.
Seine Stimme hatte Mühe gehabt, die imposante
Halle zu füllen.
Sandsteinsäulen. Emporen. Freigestellte Kanzel.
Zweihundert Jahre nach der Reformation hatte man sämtliche
Register des herrschaftlichen Bauens gezogen.
Bei der Einweihung der prächtigsten protestantischen
Kirche auf dem Gebiet der damaligen Eidgenossenschaft
war von einem Tempel gesprochen worden.
Genau hundert Jahre danach hatte er seinen Dienst
im Repräsentationsbau des altbernischen Protestantismus
angetreten. Dreissig Jahre nach dem Untergang des
Alten Bern. Dem Ende der alten Eidgenossenschaft.
Wahrscheinlich hatte man sich auch an seinem Sprachfehler
gestossen.
Schon in seiner Studentenzeit, als er acht Jahre lang
in Bern lebte, verunmöglichte ihm dieser die
Schauspielerei. Seinetwegen entzog man ihm die Rolle
des Melchthal im „Wilhelm Tell“, die er
einstudiert hatte.
Sind wir denn wehrlos? Wozu lernten wir die Armbrust
spannen und die schwere Wucht der Streitaxt schwingen?
Jedem Wesen ward ein Notgewehr in der Verzweiflungsangst.
Für das Predigthalten waren seine körperlichen
Voraussetzungen nicht optimal.
Als Schulinspektor, in der Armenpflege und sogar im
Umgang mit dem Stadtgesindel hatte er ebenfalls sein
Bestes zu geben versucht.
Aber auch das schien nicht genug gewesen zu sein.
Man wollte ihn nicht.
Nicht als Nachfolger des verstorbenen Aufklärers
Wyttenbach. Und auch sonst nicht.
Man vertrieb ihn.
Einmal mehr.
Wie in Utzenstorf. Wie in Herzogenbuchsee.
Wie im Grunde schon sein Vater vertrieben worden war,
in Murten, als das mittelalterliche Seestädtchen
in der von Napoleon neugeformten Eidgenossenschaft
ganz an das katholische Freiburg überging und
der Pfarrer, als er achtundvierzig und sein ältester
Sohn acht Jahre alt war, sich um eine Versetzung
bemühen musste.
Sie werden daher von nun an Ihres Vikariats in Herzogenbuchsee,
das Sie, wie die Visitationsberichte ausweisen, zur
Zufriedenheit der Gemeinde und ihres Pfarrers, sowie
auch des Kirchenkonvents versehen haben, in Ehren
entlassen. Bleiben Sie unsrer Wertschätzung und
Freundschaft versichert. Gott mit Ihnen. Namens des
Kirchenkonvents. Der Aktuar.
Auf der weissen Fläche neben der Strasse überschlug
sich ein Hase. Mitten im Lauf von einer Kugel getroffen.
Auf dem Boden liegend zuckte er noch einige Male.
Dann fiel er schlaff in sich zusammen.
Blut floss in den Schnee.
Es war kalt. Der Himmel bedeckt. Der Tag wollte nicht
hell werden. Im Gegenteil. Er dunkelte schon wieder
ein. Es würde zu schneien beginnen.
Wie gern war er mit seinem Bruder auf die Jagd gegangen.
Fritz tötete statt Tiere nun Menschen.
Wann würde er selber wieder jagen?
Würde er überhaupt je wieder jagen?
Was erwartete ihn?
Wandlung
Roman zur Jahrtausendwende, Teil 1, Stämpfli Verlag, Bern, 2012

Gespiegelt und reflektiert in der Geschichte eines Klubs, der sich „Club Freitag der Dreizehnte“ nennt, umfasst dieser Roman den Zeitraum vom Zusammenbruch der Sowjetunion Ende 1991, dem vermeintlichen „Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus“, bis zur Jahrtausendwende.
Letztlich meint „Wandlung“ indes die sich schon seit viel längerer Zeit im Gang befindende Verwandlung der natürlichen Umwelt auf dem Planeten Erde in eine reine Kunstwelt. In eine Welt, die nur noch aus künstlichen Gebilden besteht und eine bessere Welt als die bisher vorhandene, natürliche Welt werden soll, von der Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) noch glaubte, dass sie „die beste aller möglichen Welten“ sei.
» Stimmen und Leseprobe » Dieses Buch kaufen» als eBook
Stimmen
„Er ist ein melancholischer Moralist, kein dröhnender Apokalyptiker, ein Mahner, kein Bussprediger, ein sorgenvoller Beobachter unserer Modernisierungsprozesse und ein Fortschrittsskeptiker, der wie ein guter Buchhalter immer ein Auge darauf hat, was uns all das kostet, was wir glauben, uns leisten zu müssen. Dabei geht es ihm nicht um Geld: Die Unkosten, die Meyer abwägt, wiegen schwerer und sind mit Gold nicht aufzuwiegen. Es geht ihm um die Schweiz. Und um die Menschheit. Man könnte sagen: E. Y. Meyer ist einer der letzten Apostel der Aufklärung.“
Hubert Spiegel von der FAZ
» Weltwoche vom 9.8.12
„Sätze der Beobachtung werden zu Zeichen an der Wand“
» Aargauer Zeitung vom 31.7.2012
„Immer am Freitag, dem Dreizehnten“
» Neue Luzerner Zeitung vom 14.8.2012
„Warnung vor einer heiligen Nutte“
» Berner Bär vom 14.8.12
„Rufer in der Wüste: Ein Mann wie Meyer schielt nicht auf die Vorgaben des Marktes – er bleibt sich treu.“
» NZZ vom 28.10.12
„Hie und da sollte wieder klar gestellt werden, was das Geschäft der Literaturkritik wäre: Nicht Selbstdarstellung des Kritikers auf Kosten des Autors, sondern faire, sachlich begründete Charakterisierung eines Textes.“ Dies schreibt der Germanist Alfred Reber zu zwei, wie er findet, „von boshafter Häme“ durchsetzten Verrissen, die in der Lokalpresse von Meyers Wohnort Bern auf Grund von hier vorhandenen persönlichen Ressentiments gegen den Autor erschienen sind. In einem der beiden Fälle stellt er fest: „Der Rezensent erhebt den Anspruch, das abschliessende, allgemeingültige Urteil zu sprechen; obendrein reicht er seinen Text, zwar gekürzt, aber in Ton und Inhalt wenig verändert, dem ‚Tagesanzeiger‘ weiter, so dass sein Verriss auch im Raum Zürich bekannt wird.“ » Kritik oder Verriss? Sprachkreis Deutsch – Mitteilungen Nr. 3+4/2012
Leseprobe
Das erste Treffen hatte fünfzehn Jahre zuvor stattgefunden. Zwei Monate später im Jahr. Am Freitag, dem 13. August 1993.
Nicht zufällig in einer anderen Landesgegend. Nicht in den Bergen. Nicht in den Alpen. Sondern in flacheren Gefilden.
An einem Ort, der mir seit meiner Jugend vertraut war. Den ich damals oft und auch später immer wieder aufgesucht hatte.
Es war eine Insel auf einer Insel sozusagen.
Die St. Petersinsel im Bielersee. Im Schweizer Seeland. Dem Land der drei Seen am Südfuss des Schweizer Juras. Auch bekannt als Rousseau-Insel.
Ein Ort, der gleichzeitig seine natürliche Schönheit bewahrt und eine weiterführende geistesgeschichtliche Bedeutung hatte. Ein geographisch und historisch mit einer besonderen Bedeutung besetzter und im Bewusstsein der Menschheit verankerter Raum somit, der für das Wesentliche unserer Treffen stand. Für alle weiteren Treffen wegweisend sein sollte.
Eine Insel der Erinnerung.
In einem Land, das eine Insel war.
Eine Insel in Europa.
Eine Insel in der Welt.
Eine Insel im Universum.
Die Idee zu den Treffen, den Zusammenkünften einer besonderen Art, hatte ich ein Jahr zuvor gehabt.
Im dritten Jahr nach der sogenannten Wende, mit der die Spaltung der Welt einmal mehr vermeintlich aufgehoben worden war. Neunzehnhundertzweiundneunzig.
In Zahlen: 1992.
Herausgefordert durch die Absurdität der Behauptung des USamerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte, das mit dem Zusammenbruch der UdSSR und der von ihr abhängigen sozialistischen Staaten erreicht worden sei. Eingeleitet durch den Fall der Berliner Mauer 1989.
Im zweihundertsten Jahr nach dem Beginn der Französischen Revolution.
Das behauptete Ende hatte mich gereizt, etwas dagegenzusetzen. Und was hätte das anderes sein können als sein Gegenteil. Und was konnte das Gegenteil eines Endes anderes sein als ein Anfang.
Ein Anfang also.
Aber ein Anfang von was?
Der Anfang einer Geschichte.
Aber was für einer Geschichte?
Apotheose
Roman zur Jahrtausendwende, Teil 2, Stämpfli Verlag, Bern, 2015

„Apotheose“ heisst „Vergöttlichung“. Ein Mensch oder eine Sache wird zu einem Gott erhoben. Die Frage, die sich heute stellt, ist, ob jeder Mensch sich zu einem Gott erheben will. Ob die Menschheit sich als eine gottähnliche, mit göttlicher Allmacht versehene Spezies sehen will.
Oder ob es nicht darum gehen sollte, dass die Menschen menschlicher werden als sie es heute sind oder sein können.
„Apotheose“ beschliesst das Jahrtausendwende-Romanprojekt, das mit dem Roman „Wandlung“ begonnen hat.
Nachdem „Wandlung“ den Zeitraum des Zusammenbruchs der Sowjetunion Ende 1991 bis zur Jahrtausendwende umfasst, geht es in „Apotheose“ jetzt um die Zeit von der Jahrtausendwende bis zur ersten grossen Krise des „siegreichen Kapitalismus“: Der Finanzkrise von 2008.
Zusammen bilden die beiden Romane somit eine Art Diptychon in der ursprünglichen, aus der Antike stammenden Bedeutung des Wortes: Ein Block aus zwei mit einem einfachen Scharnier verbundenen, zusammenklappbaren Wachstafeln, die als Schreibflächen dienten.
» Stimmen und Leseprobe » Dieses Buch kaufen» als eBook
Stimmen
» Sprachkreis Deutsch, November 2017
» lesefieber.ch, 28. August 2015
„Sie haben einen Herrenclub gegründet und sind die Männer vom Freitag des 13., so treffen sie sich immer an diesen Freitagen des Jahres und stimmigerweise sind sie auch dreizehn Clubmitglieder. Männer von Welt, Männer, jeder mit einer eigenen Geschichte und Prägung, einer unter ihnen, wir ahnen welcher, mit einer unglaublichen Begabung zum Geschichtenerzählen. Wir vernehmen, wie viele Freitage den 13. ein Jahr bereithalten kann, wir sitzen in Sils Maria in der Arvenstube und trinken herrlichen Wein, philosophieren, politisieren und fabulieren mit dem auserwählten Herrenclub. Die Expo.02 taucht auf und auch viele weitere Erinnerungen aus der Schweiz aber auch Einschneidendes aus der ganzen Welt. Besonders erheiternd die Erzählung, wie der Neuenburgersee in eine gewaltige Bouillabaisse verwandelt wird, welche man dann gemeinsam auslöffelt. Zuerst die Kantone an die Löffel, dann die Auslandschweizer und zuletzt, schon mit ein wenig Sand vom Grund in der Suppe, dürfen die Ausländer am Ende die Suppe auslöffeln. Ja und salopp ausgedrückt, müssen dann der eine und andere im Club schon den Löffel abgeben, der Club ist nicht mehr derselbige, der er bei seiner Gründung war und wird darum aufgelöst.“

„Fazit: Kunterbuntes Herrengemälde aus der Schweiz der Jahrtausendwende
Der bekannte Autor Meyer verlangt uns in diesem Roman einiges ab, dies ist kein Buch, welches man einfach so weglesen kann. Aber wer bereit ist, sich auf eine Reise zu machen durch die Zeit, die Schweiz und allerhand Themen von Apotheose über Engel bis hin zu Politik, Literatur und Weltgeschehen, der wird an manchen Exkursen dieses Romans seine Freude haben. Nicht zuletzt zeigt sich der Autor auch von einer fein humorvollen, oft ironischen Seite. Nicht für jedermann, aber für diejenigen welche …“
Manuela Hofstätter, lesefieber.ch
Leseprobe
Draussen war der sonnige Tag verglüht und hatte Platz gemacht für Dunkelheit und Kälte.
In der Halle loderte das Kaminfeuer.
Und dann, nach dem Abendessen, das wir wieder im Rittersaal im ersten Stock eingenommen hatten, setzte ich mich um halb neun, einen Stock höher, im Theatersaal der Chasa de Capol, der Scena Capol, nachdem die anderen Clubmitglieder und E.T.A. sich in den roten Plüschsesseln niedergelassen hatten, ein zweites Mal neben dem Steinway-Flügel in das helle Licht auf der Bühne, auf den Stuhl, der hinter dem kleinen Tisch stand, und las zuerst den Titel und dann den Text der Geschichte, die ich für diesen Tag, für den Freitag, den 13. Dezember 2002, geschrieben hatte.
DER STALLMEISTER
VON SIEBENTHAL betrachtete die beiden Männer, die ihm gegenübersassen
Sie mochten um die vierzig sein. Beide hatten einen athletischen Körperbau, auf ihren Bäuchen jedoch eine beachtliche Menge Fett angesetzt. Sie waren ihm nicht unsympathisch. Aber sie waren keine einfache Kundschaft. Beide hatten ihre Haare nach hinten gekämmt und trugen Brillen. Brillen mit dünnen Rändern.
Der kleinere, der dichtes, blondes Haar hatte und die Schultern leicht nach vorn gebeugt hielt, sah aus wie ein schlecht gealterter David Hemmings. Jener englische Schauspieler, der im Film Blow Up von Michelangelo Antonioni den Londoner Fotografen spielte, der, ohne es zu wissen, mit seiner Kamera einen Mord festhielt.
Der andere, dessen Haare bereits stark gelichtet und am Ergrauen waren, sah aus wie ein Verschnitt aus Orson Welles, Marlon Brando und Hemingway. Ebenfalls nicht allzu gut gealtert.
Beide behaupteten, freischaffende Schriftsteller zu sein. „Was wollen Sie von uns?“, sagte der grössere, der mehr als sein Begleiter sprach und aufsässiger war. „Wir haben nichts Böses getan!“
Von Siebenthal befürchtete, dass der Abend länger werden würde, als er gedacht hatte, und dass seine Freundin und deren Kinder mit der Geschenkeverteilung nicht mehr auf ihn würden warten können.
„Ich habe Ihnen erklärt, warum wir Sie befragen. Wir möchten wissen, was es mit den Marienkäfern auf sich hat.»
„Himmelskäfer“, sagte der kleinere Mann, der Bieler hiess. „Siebenpunkter“, sagte der grössere Mann, dessen Name, wie die Ausweispapiere bestätigten, Mueller war. Mueller mit ue geschrieben. Und auch so gesprochen, wie er betonte.